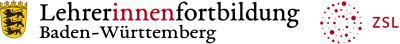Schreibtechniken, Schreibstrategien, Schreibhaltungen
Förderansätze
Philipp (2017, 193; 2019, 71) nennt als allgemeine Ansätze zur
-
Förderung basaler Fertigkeiten: Schreiben per Hand und Tastatur, Wortschatz erhöhen sowie Sätze kombinieren (vgl. M 2b)
-
Förderung höherstufiger Schreibfähigkeiten: Schreibstrategien vermitteln, klare Produktziele setzen, Vorbereitung des Schreibens, Textstrukturwissen vermitteln (hier sollte man unbedingt die oben genannte Dimension der Texthandlungen (Texthandlungstypen und Textprozeduren) als handlungsbezogene Tiefenstruktur der zu schreibenden Texte ergänzen!)
-
personellen und technischen Entlastung: Kooperatives Schreiben, Feedback durch die Lehrperson, Nutzen von Textverarbeitungssoftware, Modelle studieren (Schreiben nach Mustern, Stilübungen), mehr Schreibzeit geben.
Interessant ist die Frage der Quantität. Schreiben braucht Zeit; zusätzliche Schreibzeit zu geben, hat einen (nicht übermäßig) positiven Effekt (vgl. Philipp 2017, 192). Übung hilft zweifellos; ein deutlicher Effekt der Förderdauer ist für hierarchieniedrige Fähigkeiten (Leserlichkeit und Schreibflüssigkeit) belegt (vgl. Philipp 2019, 78). Generell ist es hilfreich, Schreibanlässe zu schaffen. Dabei geht es weniger um eine Systematisierung, sondern um motivierende, offene Schreibanlässe, die Praxis (und damit Übung) und Schreibengagement verschaffen, z. B. durch ritualisierte Phasen des freien Schreibens.
Strategien
Sehr allgemein setzt Hans-Peter Ortner an. Der Vorteil seiner Zusammenstellung ist, dass er eine große Vielfalt von Schreibprozessen in den Blick bringt, während häufig in der Schreibförderung von vorne herein auf das planende Schreiben nach dem Modell der Rhetorik abgehoben wird.
Allgemeine Schreibstrategien (nach Ortner 2010) |
Ideen zur Umsetzung |
|---|---|
|
Schreiben in einem Zug (Flow-Schreiben) |
ecriture automatique |
|
Einen Text zu einem Thema, einem Impuls, einer Idee schreiben (≈ Knowledge-Telling-Strategie) |
Zusammenfassung eines Dossiertextes (Abstract, precis …) Kurztext oder Kernthese zu einem Diagramm Umsetzung eines Schaubildes in Fließtext Bildbeschreibung Schreiben von Gegentexten |
|
Schreiben von mehreren neuen Textversionen zu einer Idee (Pingpong zwischen Idee und Textversionen, Reflexion) |
Springen zwischen Dossier/Impulsen und Textproduktion (z. B. in Stationen) allmähliche Erweiterung der Impulse allmähliche Ergänzung eines fremdem (fakultativ gekürzten) Essays (auch am Computer) kooperatives (Fort-)Schreiben eines Textes (auch am PC) Schreiben von Gegentexten als Schreibgespräch |
|
Herstellen von Texten durch redaktionelle Arbeit (Überarbeiten eines Textes) |
Schreibkonferenzen Überarbeitung nach Rückmeldung durch Zettellawinen, Textlupen, Placemats, … Herstellung von sinnvollen Kürzungen parataktischen in hypotaktischen Text umwandeln |
|
Planendes Schreiben (bewusste Kompositionsidee) |
systematische (ggf. gemeinsame) Planung eines Textes, individuelles Ausschreiben graphische Darstellung einer geplanten Textstruktur Erstellen und/oder Vergleichen von Gliederungen |
|
Einfälle gedanklich entwickeln und dann niederschreiben |
stummes Nachdenken, Phantasiereise, Meditation … mit anschließender Schreibphase Gespräch und anschließendes Notieren der Ideen eigenständige Fixierung von Diskussionsstunden mündliches Extemporieren, Auf- oder Mitschreiben |
|
Schrittweises Vorgehen gemäß der Produktionslogik (sammeln, disponieren, formulieren, korrigieren) |
Durchlaufen des ganzen Prozesses (methodisch homogen – Methodenwechsel) |
|
Synkretistisch-Schrittweises Schreiben („chaotisches“ Arbeiten an verschiedenen Textteilen, Hin- und Herspringen) |
Schreiben an gemeinsamen Texten mit Autorenwechsel stummes Schreibgespräch Ausschreiben eines Clusters |
|
zerlegendes Schreiben, nichtlineare Produktion von Textteilen |
arbeitsteiliges Produzieren eines gemeinsames Schreibplanes, Zusammenführung mit geeigneten Überleitungen arbeitsteiliges Schreiben eines stilistisch einheitlichen Textes Schreiben von Fragmenten zu einem Thema Schreiben von einzelnen Texten zu jeweils verschiedenen Dossiermaterialien, dann Integration |
|
exploratives Schreiben nach dem Puzzleprinzip (bleibt in der Regel fragmentarisch, kein klares Schreibziel) |
dto. mit Ergänzung eigener Stichwörter und Bausteine Lesetagebuch Schreiben von Abstracts, die dann schrittweise miteinander verbunden und in größere Texteinheiten verbunden werden. |
Strategiebündel des planenden Schreibens
Die wesentlichen Modelle orientieren sich am allgemeinen Ansatz des prozessorientierten Schreibens (und damit letztlich auch am Modell der Rhetorik als dem klassischen Modell der ziel- und adressatengerechten Textproduktion).
-
Diese Grundstrategie muss den Schülerinnen und Schülern bekannt sein, um bewusst und zielführend angewandt zu werden.
-
Die Strategiebündel geben lediglich eine grobe Handlungsorientierung. Die einzelnen Schritte bedürfen der weiteren Konkretisierung, d. h. die Beherrschung von Strategien des Planens, des Formulierens und des Überarbeitens.
-
Diese einzelnen Strategien sind meist text- und situationsspezifisch.
SIRAN Quelle Philipp 2019, 92 f. kombiniert zwei Ansätze (SIR und IRAN) |
PIRSCH+ Quelle Sturm/Weder 2016 |
Erläuterung |
|---|---|---|
|
Schreibziel festlegen |
Planen |
Schreibarrangements mit entsprechender Situierung anbieten und SuS dazu befähigen, diese zu nutzen |
|
Ideen sammeln |
Ideen notieren und auswählen |
inventio komplexe, inhaltlich entscheidende und oft vielschrittige Vorarbeit schreibformspezifische Strategien anwenden:
|
|
Reihenfolge der Ideen festlegen |
Reihenfolge festlegen |
dispositio |
|
Aufschreiben |
Schreiben |
elocutio |
|
Noch mehr schreiben |
+ Überprüfen |
PIRSCH+ stellt hier auf Aufbau und vollständige Berücksichtigung des Schreibplanes ab; hier sind auch höherstufige Prüfprozesse sinnvoll (z. B. Verständlichkeit, Plausibilität, Vollständigkeit der Disposition, Gewichtung usw.) (S)IRAN setzt den Impuls von vorne herein sehr offen und rein quantitativ. Die Anregung evoziert einen genaueren Blick auf den Text (Wo fehlt etwas? Was lässt sich noch genauer und differenzierter fassen?), wirkt aber nur implizit; in Fällen mangelnder Strukturierung oder Klarheit weniger hilfreich. |
Zwischenspurt Deutsch: Herunterladen [pdf][2 MB]
Weiter zu Links zur Schreibförderung