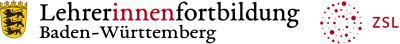Literaturwissenschaftl. Einordnung & Deutungsperspektiven
Huchs Brieferzählung lässt sich zur Neoromantik zählen. Sie kann als Unterhaltungs- und Kriminalgeschichte gelesen werden, aber auch als psychologische Studie. Ein zentrales Thema der Brieferzählung ist der Generationenkonflikt, wonach sich die jüngere Generation, repräsentiert durch die Kinder des Gouverneurs, in unterschiedlicher Intensität von den despotischen politischen Maßnahmen des Vaters als Vertreters des zaristischen Reiches zu distanzieren beginnt, wenngleich die Liebe zu den Eltern ungebrochen bleibt. Dies wird etwa in den Briefen Weljas an Peter deutlich. Ferner zeigen dies Briefe Ljus an Konstantin im Blick auf Streitgespräche zwischen Katja und ihrem Vater bezüglich der Universitätsschließungen, in denen Katja die Aufständischen sogar als „Märtyrer“ bezeichnet. Die Tochter zeigt sich politisch eigenständig und ist dem starken Vater als Kritikerin gegenübergestellt. Bezeichnenderweise wird im Gesprächsverlauf auch deutlich, dass der Vater Ljus Kritikpunkte, wonach das Pflichtgefühl der Menschen sich aufgrund zu vieler Gesetze nicht ausbilden lasse, unterschätzt. Der Vater kommt durchgehend weniger als Privatperson, denn als Vertretung der Regierung in den Blick (vgl. Staitscheva 1997). Der „Rebell“ Liu trägt „Züge moderner bürgerlich-intellektueller Weltempfindung“ (Staitscheva 1997), seine Haltung ist von Schopenhauer und Nietzsche geprägt (vgl. Staitscheva 1997). Ferner sind in der Figur des Attentäters Züge von Karl Marx und Michael Bakunin zu entdecken (vgl. Staitscheva 1997). Das Besondere an ihm ist, dass er als kritischer Anarchist stets in Distanz zu sich und zu seiner Umwelt bleibt und gerade nicht aus rein sozialen Motiven heraus handelt, sondern eine Selbstbestätigung sucht (vgl. Ba 1974).
Am Rande der Brieferzählung wird die Begeisterung der Kinder für die Musik Richard Wagners erwähnt, die der Vater hingegen symptomatisch ablehnt, wohl weil sie ihm ein Ausdruck von Ungehorsam und ein Ausdruck des neuen Zeitgeistes ist. Denn Wagner war ein führender Kopf der 1848-Revolution in Dresden und Wien. Bakunin, der Wagners Musik schätzte, kannte er persönlich. Aufgrund seines Kontakts zu Bakunin musste Wagner nach Zürich fliehen
Die Mutter nimmt im Figurenensemble eine Sonderposition ein, da sie „das Motiv des Intuitiven und Unbewußten“ (Staitscheva 1997) verkörpert, ebenso zeigen sich in ihrem Empfinden und Verhalten typische dekadente Angstempfindungen um 1900 (vgl. Staitscheva 1997), wonach das Geschehen eine fatalistische Note verliehen bekommt.
Das in der Brieferzählung häufig verwendete Sonnenmotiv passt zum Titel „Der letzte Sommer“, der die Sommerszenerie vorgibt; mit dem Zusatz „der letzte“ wird der Niedergang des alten Systems, repräsentiert durch den Gouverneur und seinen Tod, angezeigt. Zugleich suggerieren die vielen Vergleiche mit Naturelementen die Naturhaftigkeit der Geschehnisse. Am Ende artikuliert Lju passend hierzu seine Lebensweisheit: „Das alles verdammt ist zu vergehen, indem es entsteht, das ist die einzige Tragik des Lebens.“
Die Besonderheit der Erzählung, zahlreiche Briefe von verschiedenen Figuren aufeinanderfolgen zu lassen, eröffnet durchgehend eine Multiperspektivität auf das Geschehen. Das Medium Brief bietet eine authentische und unmittelbare Wiedergabe der Gedanken und Gefühle der einzelnen Figuren.
Textausgaben:
Ricarda Huch: Der letzte Sommer. Eine Erzählung in Briefen. Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart und Leipzig 1910.
Ricarda Huch: Der letzte Sommer. Eine Erzählung. Leipzig 1920.
Ricarda Huch: Der letzte Sommer. Eine Erzählung in Briefen. Berlin 2019.
Huch: „Der letzte Sommer“: Herunterladen [pdf][175 KB]
Weiter zu Didaktische Hinweise & Vernetzung