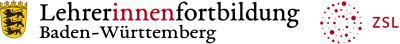Literaturwissenschaftl. Einordnung & Deutungsperspektiven
„Es ist nur so, als fände man in einem Schubfach ungeordnete Papiere und fände eben vorderhand nicht mehr und müßte sich begnügen. Das ist, künstlerisch betrachtet, eine schlechte Einheit, aber menschlich ist es möglich, und was dahinter aufsteht, ist immerhin ein Daseinsentwurf und ein Schattenzusammenhang sich rührender Kräfte.“ - So beschreibt Rilke den fragmentarischen Charakter seiner Aufzeichnungen, die aus heterogen wirkenden Versatzstücken zu bestehen scheinen. Auf das Innovative der Erzähltechnik wird in der kritischen Literatur zu den Aufzeichnungen häufig Bezug genommen und von einer Krise oder gar Auflösung des Erzählens im modernen Roman ist die Rede. Diese Form des Schreibens wird mit der veränderten Wahrnehmung des Menschen in der modernen Welt in Verbindung gebracht, die im Malte durch die Großstadt Paris dargestellt wird: Der Ich-Erzähler, der kein Erzähler im klassischen Sinne ist, ist von den disparaten Eindrücken in der Großstadt überfordert und erlebt sich selbst nicht als autonom. Sein Schreiben spiegelt das Zerfallen des Ganzen in Teile, wie es für die Literatur der Jahrhundertwende charakteristisch ist, wider.
Auch wenn die Großstadtthematik und allgemein die Erfahrung der Entfremdung zentrale Themen der Aufzeichnungen sind, griffe es zu kurz, erklärte man die Abkehr von einem traditionellen Erzählen nur mit der veränderten Wahrnehmung des modernen Subjekts in der Großstadt, wenngleich diese neue Art des Sehens Auslöser der Veränderungen, die Malte auch an sich selbst wahrnimmt, ist. Indessen ist Malte selbst ein Dichter, der eine neue Art der Dichtung anstrebt. In der 14. Aufzeichnung, die als zentral gelten kann, stellt Malte in einem fast biblischen Duktus infrage, dass jemals Relevantes geschrieben wurde. Insbesondere kritisiert er, dass bislang nur von anonymen Massen in verallgemeinertem Plural geschrieben worden sei, nicht aber von dem einzelnen Individuum, um das es Malte zu tun ist und das in der anonymen Großstadt ebenso untergehe wie in der Dichtung. Interessant ist in diesem Zusammenhang, wie das anonyme Sterben in der Großstadt dem individuellen Sterben auf dem Lande gegenübergestellt wird. Ein eigenes Leben ist die Voraussetzung für den eigenen Tod, beides verhindert die Anonymität der Großstadt. Auffällig ist, dass Malte nicht mehr von „Erzählen“ spricht, sondern von „Sagen“ vgl. 14. Aufzeichnung). Auf Bezüge zu Rilkes eigenem poetologischen Programm des sachliches Sagens, wie er es in den Cézanne-Briefen formulierte, wird in der Forschung immer wieder hingewiesen. In einem Brief vom 19.10.1907 an Clara Rilke geht Rilke auf eine Textstelle aus den Aufzeichnungen ein, in der auf Baudelaires Gedicht Une charogne (Ein Aas) angespielt wird. In der 23. Aufzeichnung wird Baudelaires Ästhetik des Hässlichen zum Ausgangspunkt für Maltes (und Rilkes) eigenes poetologisches Programm: Über den Dichter, der ein Aas zum Gegenstand eines Gedichts macht, heißt es: „Es war seine Aufgabe, in diesem Schrecklichen, scheinbar nur Widerwärtigen das Seiende zu sehen, das unter allem Seienden gilt. Auswahl und Ablehnung giebt es nicht.“ In Baudelaires Gedicht sieht Rilke den Beginn einer Entwicklung zum sachlichen Sagen, das er auch in Cézannes Malerei wiederfindet und in seinen eigenen Dinggedichten, in denen die Dinge selbst zur Sprache gebracht werden, verwirklicht. Hinter diesem Dichtungsprogramm steht ein „Daseinsentwurf“ , der das Wirkliche gelten lässt, „selbst wenn es arg ist“. Was Rilke als Aufgabe der Dichtung formuliert, gilt auch für Malte: „Erst mußte das künstlerische Anschauen sich so weit überwunden haben, auch im Schrecklichen und scheinbar nur Widerwärtigen das Seiende zu sehen, das, mit allen anderen Seienden, gilt. Sowenig eine Auswahl zugelassen ist, ebensowenig ist eine Abwendung von irgendwelcher Existenz dem Schaffenden erlaubt“ (Rilke in dem Brief an Clara Rilke vom 19.10.1907). Malte stellt sich diesem Anspruch und beschreibt - oft in der Form des Aperçus - in knapper, sachlicher Sprache die abscheulichen olfaktorischen, akustischen und optischen Eindrücke, die sich ihm in Paris bieten (wie z.B. hässliche, kranke Menschen oder die Überreste abgerissener Häuser die noch Spuren von den Nöten ihrer ehemaligen Bewohner tragen, vgl. 18. Aufzeichnung). Diese Eindrücke lösen in Malte allerdings eine Furcht aus, die sich zu einer als existentiell empfundenen Angst ausweitet. Es gelingt Malte nicht, das Seiende in seiner Entsetzlichkeit gutzuheißen. Insbesondere in seinem Bemühen, sich von den „Fortgeworfenen“ abzugrenzen, wird deutlich, dass er Unterschiede macht und als der „rühmende“ Dichter (bislang) gescheitert ist: „Ist es nicht das, daß diese Prüfung ihn überstieg, daß er sie am Wirklichen nicht bestand, obwohl er in der Idee von ihrer Notwendigkeit überzeugt war“, schreibt Rilke über das Schicksal seines Malte.
Den großen Liebenden dagegen scheint zu gelingen, was Malte bislang versagt ist: das Seiende wie es ist gutzuheißen. In der 24. Aufzeichnung wird als weiteres zentrales Thema die Liebe eingeführt. V.a. die Mutterliebe vermag, den Dingen das Unheimliche zu nehmen und die Furcht zu besiegen. Sie macht keine Unterschiede und ist bedingungslos, wie auch die Liebe der Heiligen und Jesu. V.a. die Frauen, wie Sappho und ihre Schülerin, Bettine von Arnim, Héloïse oder Gaspara Stampa, scheinen zu dieser Art der Liebe fähig zu sein: In ihrer bedingungslosen Liebe überholen sie den Geliebten und ihre Liebe wird damit zu einer objektlosen, intransitiven Liebe.
Aus Angst lernt Malte sehen, aber nicht die Dinge schreibend zu rühmen. Liebend könnte die Angst überwunden werden und Malte würde sich zu dem Dichter entwickeln, der er sein möchte. Maltes (und Rilkes) Dichtungsprogramm hat damit eine existentielle Dimension und entsprechend formuliert Rilke als die zentrale Aussage seiner Aufzeichnungen: „Was im Malte Laurids Brigge [...] ausgesprochen eingelitten steht, das ist ja eigentlich nur dies:Dies, wie ist es möglich zu leben, wenn doch die Elemente des Lebens uns völlig unfaßlich sind? Wenn wir immerfort im Lieben unzulänglich, im Entschließen unsicher und dem Tode gegenüber unfähig sind, wie ist es möglich dazusein?“ (Rilke in einem Brief vom 08.11.1915 an Lotte Hepner)
Bei aller Heterogenität der Aufzeichnungen wird doch sehr konsequent Maltes Scheitern dargestellt.
Eine solche skeptische Haltung gegenüber der Welt, der Sprache und dem eigenen Ich ist charakteristisch für zahlreiche Texte der Jahrhundertwende. Wie kaum ein anderes Werk stehen Rilkes Aufzeichnungen für den programmatischen Neubeginn der Literatur nach der Zeit der Großen Erzählungen.
Textausgaben:
Manfred Engel, Ulrich Fülleborn, Horst Nalewski, Ausgust Stahl (Hrsg.): Rainer Maria Rilke: Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. Text und Kommentar. Frankfurt a. M. 2000.
Schmidt-Bergmann: (Hrsg.): Rainer Maria Rilke: Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. Frankfurt a. M. 2000.
Rilke, Rainer Maria: Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. Frankfurt a. M. 1982.
Text frei zugänglich z.B. bei Bibliothek Gutenberg: Projekt Gutenberg
Rilke: „Malte Laurids Brigge“: Herunterladen [pdf][225 KB]
Weiter zu Didaktische Hinweise & Vernetzung