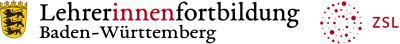Inhalt
Auch wenn die Aufzeichnungen weder eine chronologische noch sonst kausal verknüpfte Erzählstruktur aufweisen, so lassen sich doch rudimentäre Elemente einer Handlung rekonstruieren: Malte befindet sich zu der Zeit, in der er seine Aufzeichnungen niederschreibt, im Paris kurz nach der Jahrhundertwende. Die Eindrücke der Großstadt überwältigen den 28-jährigen Malte. Er nimmt v.a. ihre hässliche, abstoßende Seite wahr. Die äußeren Sinneswahrnehmungen finden eine Resonanz in seinem Inneren und bewirken zunächst eine veränderte Wahrnehmung, die Malte als ,Sehenlernen‘ charakterisiert, schließlich aber auch eine Veränderung seiner Persönlichkeit bzw. eine Selbstentfremdung. Insbesondere die ,Fortgeworfenen‘, Randexistenzen der Gesellschaft wie Bettler, Arme und Prostituierte, ziehen Maltes Aufmerksamkeit auf sich, fürchtet er sich doch davor, selbst zu den Fortgeworfenen zu gehören. Verschiedene Erkennungszeichen jener, die Malte wahrzunehmen glaubt, scheinen dies nahezulegen. Schließlich befindet sich Malte als verarmter Abkömmling eines dänischen Adelsgeschlechts selbst in einer materiell prekären Situation. Auch das Sterben und den Tod nimmt er überall in Paris wahr, wobei ihn v.a. die Anonymität des Sterbens in der Großstadt abstößt. Die überwiegend negativen Eindrücke in der Metropole bewirken schließlich, dass sich Malte an seine Kindheit zurückerinnert, die durch eine ländliche Umgebung, die kontrastiv zur Großstadt dargestellt wird, geprägt ist.
In der 14. Aufzeichnung, die als eine Art nachgeholte Exposition gelten kann, wird deutlich, dass Malte Verse schreibt und eine neue Art der Dichtung bzw. Literatur anstrebt, die nicht mehr erzählen, sondern nur noch „sagen“ will. Seine Ausführungen zu den Bedingungen dieser Art der Dichtung lassen erkennen, dass Erinnerungen und Erfahrungen dafür unerlässlich sind. Maltes Erinnerungen beziehen sich v.a. auf seine Kindheit und seine Familie, die neben der Großstadt-Thematik einen zentralen Themenkomplex ausmachen. Prägende Kindheitserfahrungen für Malte sind das Sterben Familienangehöriger wie seiner Großväter Brigge und Graf Brahe und seiner Mutter, das im Unterschied zum anonymen Sterben in der Großstadt als individuell und zur Person passend dargestellt wird. Auch an seine Beziehungen zu verschiedenen Familienmitgliedern, insbesondere an das innige Verhältnis zu seiner früh verstorbenen Mutter und die unerwiderte Liebe zu Abelone, der jüngeren Schwester der Mutter, erinnert sich Malte. Bereits während seiner Kindheit macht Malte aber auch Fremdheitserfahrungen, wenn er z.B. seine eigene Hand nicht mehr als zu ihm gehörig erkennt (vgl. 30. Aufzeichnung), und die Furcht, sowohl die Furcht vor dem Tode als auch die Gespensterfurcht, begleitet ihn schon als Kind. Der Affinität seiner gesamten Familie zu spiritualistischen Haltungen, in denen das Erscheinen toter Personen wie der verstorbenen Christine Brahe als ebenso selbstverständlich hingenommen wird wie das Vorhandensein eines abgebrannten Hauses, widmet Malte mehrere Aufzeichnungen. Malte betont hier die Einbildungskraft seiner Familienangehörigen, die auch für ihn als Dichter essentiell ist.
Einen weiteren Themenkomplex stellen Reminiszenzen an große Persönlichkeiten wie Dichter (wie z.B. Ibsen und Baudelaire) und Dichterinnen (wie z.B. Sappho und Bettine von Arnim) und Heilige (wie Jesus) oder auch Künstler (wie Cézanne und Beethoven) dar, die Malte z.T. als Vorbilder für seine Sichtweise der Welt und dadurch auch für seine Dichtung dienen. Den ,großen Liebenden‘, v.a. den Frauen wie Sappho, Bettine von Arnim, Héloïse oder Gaspara Stampa scheint es gelungen zu sein, was Malte bislang versagt ist: der Welt als Dichter liebend zu begegnen und keine Unterschiede zu machen, auch nicht beispielsweise gegenüber den ,Fortgeworfenen‘. Erstrebenswert erscheint ihm eine Art intransitive Liebe, die an kein Objekt mehr gebunden ist. Auf diese Vorstellung der Liebe zielt auch Maltes Umdeutung des Gleichnisses vom verlorenen Sohn ab, als der er sich begreift. Mit der Kontrafaktur des Gleichnisses, die auch die von Malte empfundene Gottesferne zum Thema hat, enden die fragmentarischen Aufzeichnungen.
Textausgaben:
Manfred Engel, Ulrich Fülleborn, Horst Nalewski, Ausgust Stahl (Hrsg.): Rainer Maria Rilke: Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. Text und Kommentar. Frankfurt a. M. 2000.
Schmidt-Bergmann: (Hrsg.): Rainer Maria Rilke: Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. Frankfurt a. M. 2000.
Rilke, Rainer Maria: Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. Frankfurt a. M. 1982.
Text frei zugänglich z.B. bei Bibliothek Gutenberg: Projekt Gutenberg
Rilke: „Malte Laurids Brigge“: Herunterladen [pdf][225 KB]