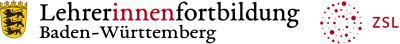Didaktische Hinweise & Vernetzung
Didaktische Hinweise
Als Hinführung bietet es sich an, Vorstellungen vom Urlaub in Italien am Strand und Erlebnisse mit der Hochkultur Italiens zu sichten, um die eigentümliche Atmosphäre in Torre de Venere in den Blick zu bekommen. Alternativ lässt sich der Topos von der Italiensehnsucht der Deutschen durch eine Besprechung von Goethes Mignons Lied thematisieren.
Eine Sichtung der brieflichen Zeugnisse lässt Thomas Manns Fiktionalisierung seines Erlebten und seine verschiedenen Interpretationsansätze erkennen (politischer versus ethischer Zugang).
Um die unangenehme Stimmung am Strand einzufangen, bietet sich eine vergleichende Analyse der Konflikte an. Als gemeinsamer Nenner kann herausgearbeitet werden, dass sie alle die ‚überhitzte’ Gemütslage der Italiener und mit ihrem patriotisch übersteigertem Würdegefühl spiegeln. Es fehlen vernünftige Urteile und Orientierungsmaßstäbe aufgrund der Fremdenfeindlichkeit der Italiener. Der „Ortsdämon“ wird gleichsam wie durch einen Brennspiegel in der Dämonie Cipollas fixiert. Blickt man auf die Erzählerkommentare wird deutlich, dass der Erzähler sein Verbleiben vor Ort beschönigen möchte und dass er aus der Retrospektive Sinnzusammenhänge im Sinne einer Leserlenkung rekonstruiert. Der Erzähler nimmt eine Doppelrolle ein: Er ist Akteur in der Geschichte und erzählt zugleich rückblickend und mit zeitlichem Abstand die Geschichte. Die zunächst unangenehmen, wenn auch relativ belanglos erscheinenden Unstimmigkeiten am Badeort werden dementsprechend von ihm aufgeladen und zu Vorboten der Katastrophe stilisiert. Eine Analyse des Wetters und seiner Umschwünge kann darauf abzielen, die Naturwüchsigkeit der Ereignisse als Suggestion zu entlarven. Auf die „offene Glut“ am Strand folgt die „Sciroccoschwüle“ und ein „schwächlicher Regen“. Auf dem Weg zur Zaubervorstellung wird nochmals die Schwüle, das Wetterleuchten und der Regen erwähnt. Die Denotationen, die Schüsse auf Cipolla werden wie ein reinigendes Donnern im Rahmen eines Gewitters stilisiert und somit als in der Natur der Dinge liegend dargestellt. Die Atmosphäre ist von Anfang an „geladen“ und wird durch die Pistolenschüsse gleichsam entladen.
Um sich der Besonderheit des Zauberers Cipolla mit seinem sprechenden Namen (italienisch Zwiebel) zu nähern, bietet sich ein Blick auf bekannte Zauberer an (wie etwa Gandalf, Harry Potter u.a.), von denen er sich als Hypnotiseur und Willensbrecher deutlich unterscheidet. Sein Auftreten mit Reitpeitsche als Symbol seiner Herrschaft, die gleichsam der Bändigung seines Publikums dient, kann mit Bildern Mussolinis oder der Zauberin Kirke mit Peitsche verglichen werden. Ausgehend hiervon lassen sich Texte zur Zeit Mussolinis und zum Faschismus in Italien sichten oder auch die mythologischen Bezüge zu Kirke im Text aufarbeiten.
Zur in der Novelle ebenfalls verhandelten Thematik Führer und Masse lassen sich Texte von Le Bon (Psychologie der Massen, 1895) und Freud (Massenpsychologie und Ich-Analyse) u.a. vergleichend beiziehen.
Ein Vergleich mit der Verfilmung Klaus Maria Brandauers ist insofern lohnenswert, als sie ein völlig anderes Ende vor Augen stellt, was zur Kritik einlädt. Der Zauberer überlebt in der Verfilmung und Mario wird anstelle des Zauberers getötet. Indem sich Cipollas Begehren auf eine Frau, nämlich Silvestra konzentriert, wird seine Konkurrenz zu Mario nochmals hervorgehoben. Gleichzeitig wird das in der Novelle anklingende homoerotische Begehren ausgeblendet.
Vernetzung
-
E.T.A. Hoffmann Der Sandmann (Coppelius und Coppola gelten als Vorbilder für Cipolla)
-
Thomas Mann: Felix Krull
-
Bertolt Brecht: Arturo Ui
-
Heinrich Mann: Die kleine Stadt
-
Heinrich Mann: Der Untertan
Textausgabe:
Thomas Mann: Mario und der Zauberer. Ein tragisches Reiseerlebnis. Frankfurt am Main (Erstdruck 1930) 2010.
Mann: „Marion und der Zauberer“: Herunterladen [pdf][176 KB]