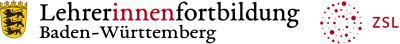Lösungshinweise
Im Umgang mit filmischen Produkten unterscheidet man dokumentarische und fiktionale Formate. Dabei gilt allgemein die Annahme, dass Dokumentationen reale Weltzustände beschreiben, während fiktionale Filme erdachte oder auch reale Begebenheiten nur vorstellen. Wir gehen davon aus, dass Personen, die wir im Dokumentarfilm sehen, tatsächlich in dieser Identität leben und handeln und dass die filmische Instanz sich tatsächlich ereignenden Begebenheiten bezeugt, sowie dass dargestellte Ereignisse nicht für die Kamera arrangiert wurden und dass die Redebeiträge der sich äußernden Personen in ihrem Inhalt nicht beeinflusst oder durch formale Manipulationen entstellt worden sind. Prinzipiell resultiert aus dieser deutlich sichtbaren Anwesenheit der Kamera bzw. des ganzen Produktionsapparats ein Arsenal bestimmter Signale, die dem Zuschauer anzeigen, ein reales Ereignis vermittelt zu bekommen. Solche Authentizitätssignale machen in der Regel die Unterscheidung zwischen vermitteltem Inhalt und vermittelnder Form sichtbar. Sie machen dem Zuschauer bewusst, eine mediale Rekonstruktion von Wirklichkeit zu sehen. Es ist also gerade die Anwesenheit des filmischen Apparats, das ein filmisch vermitteltes Geschehen glaubhaft, authentisch macht. Die Kamera greift durch ihre Anwesenheit in ein Geschehen ein, markiert aber diesen Eingriff und wird so zum Garanten für Wahrhaftigkeit.
Diese Konstellation beruht auf der Konvention, bei filmischen Fiktionen die Anwesenheit des Vermittlungsapparats um jeden Preis zu vertuschen. Nichts würde die Illusion einer Liebesszene mehr zerstören als die Vorstellung von der Anwesenheit eines mit Routine arbeitenden Filmteams. So sind im fiktionalen Film bestimmte Aktionen und Konstellationen tabuisiert, wie z.B. der direkte Blick in die Kamera.
Eben jene Signale sind dann umgekehrt die formalen Attribute filmischer Dokumentationen:
-
Wackelnde Kamera
-
Unscharfes Bild
-
Unausgewogenes Licht
-
Bildsprünge (Jump Cuts) in der Montage
-
Personen wenden sich an die Kamera
-
Redebeiträge vom Team
Fiktionalität wird durch das Ausbleiben jener Signale vermittelt:
-
Die Figuren sind alleine mit sich, sie reagieren nicht auf die Kamera
-
Die Filmmusik hört nur der Zuschauer
-
Entscheidend ist schließlich die Angabe der am Film beteiligten Schauspieler und Personen in Vor- und Abspann
Aber gerade weil diese Indizes prinzipiell unabhängig vom Inhalt der Bilder sind, lassen sie sich künstlich herstellen oder eliminieren: Fiktionale Filme können so aussehen, als ob es sich um Dokumentationen handelt (vgl. „The Blair Witch Project“, USA 1999)), reale Sachverhalte können umgekehrt so gefilmt werden, dass sie ihren Realismus verlieren.
Robert Flahertys „Nanook, der Eskimo“ (USA, 1922), ein Pionierwerk des Dokumentarfilms, manipuliert und idealisiert den Alltag der Inuit, indem er seine Protagonisten zur Seelöwen-Jagd animierte, die zu diesem Zeitpunkt längst nicht mehr Praxis der Inuit war (Borstnar/Papst/Wulff, 2008). Und Oliver Stone macht in seinem Spielfilm „JFK – Tatort Dallas“ (USA, 1991) so starken Gebrauch von Authentizitätssignalen, dass die Grenzen zwischen den wenigen historischen Filmaufnahmen vom Attentat auf John F. Kennedy und nachträglich inszenierten Szenen bis zur Unkenntlichkeit verschwimmen.
Im Grunde muss jede mediale Rekonstruktion von Wirklichkeit Fiktion bleiben. Jeder Ansatz zur Vermittlung stellt einen Eingriff in die Realität dar. Insofern bilden sich zwischen dem Dokumentarischen und dem Fiktionalen vielfache Verwandtschaften und Bezüge aus, die zu diversen Mischformen führen (vgl. Reality-Formate, Doku-Soaps).1
1 Zur filmischen Fiktion vgl. auch Beil/Kühnel/Neuhaus: Studienhandbuch Filmanalyse. München 2012. S. 167-192.
Fiktion und Fiktionalität: Herunterladen [docx][21 KB]
Weiter zu Textualität des Films